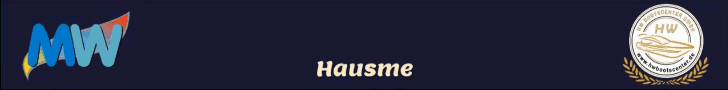So schrieb uns beispielsweise Franz Eckers: „Ich lese nun seit knapp einem Jahr regelmäßig die Zeitschrift Skipper und vermisse bei den Testberichten eine für mich (und ich denke, ich spreche da für viele) wichtige Information, und zwar jene über den Kraftstoffverbrauch. Bei den derzeitigen Diesel- und Benzinpreisen ein wichtiges Kaufkriterium. Zumindest für mich, der es nach langem Suchen immer noch nicht geschafft hat, ein passendes familientaugliches und finanzierbares Boot anzuschaffen. Ich denke mal, dass sehr viele Skipper und Freizeitkapitäne wie ich Normalverdiener sind und mit jedem Euro rechnen müssen. Ich würde mir wünschen, die Verbrauchsdaten, wie sie in dem Artikel über die ETAP 1100 AC aufgeführt wurden, als festes Thema in den Testberichten beizubehalten.“Selbstverständlich haben wir uns, liebe Leserinnen und Leser, mit dieser Thematik bereits in der Vergangenheit eingehend beschäftigt. Wir sind aber einmal mehr zu dem Entschluss gekommen, auf diese unserer Meinung nach immer individuell zu betrachtende Angabe auch weiterhin zu verzichten – wobei hier im Einzelfall nach dem Motto „keine Regel ohne Ausnahme“ verfahren werden soll. Gestatten Sie uns dazu folgende Anmerkungen: Der Diesel- oder Benzinkonsum eines jeden Boots- oder Yachtmodells wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, und dies mehr oder weniger stark. Zum einen spielt die vom Temperament des Rudergängers bestimmte Fahrweise eine enorm wichtige Rolle. Anders als auf dem Automobilsektor, wo der Verbrauch von der Motorleistung, der Form des Fahrzeugs, der Lufttemperatur, der Reifenbreite, dem Reifendruck, der Kraftstoffgüte, der effektiven Zuladung, der Qualität des Straßenbelags und vielen anderen Dingen abhängt, sind bei einem Motorboot noch einige weitere Aspekte zu berücksichtigen, die sich ständig und obendrein kaum vorhersehbar ändern können. Wir denken dabei an urplötzlich wechselnde Wind- und Strömungsverhältnisse oder unterschiedliche Wellenhöhen. Die hydrodynamische Beschaffenheit des Rumpfes, die Aufbautenhöhe und die Laufeigenschaften eines Bootes an sich wären ebenfalls ausschlaggebende Kriterien für eine glaubwürdige Verbrauchsmessung. Da es sich bei unseren Testobjekten fast ausschließlich um brandneue, also nicht „eingefahrene“ Boote und Bootsmotoren handelt, die zudem mit variierenden Kraftstoff- und Frischwasservorräten erprobt werden, könnte man zum „regulären“ Spritverbrauch des jeweiligen Bootstyps nach der notwendigen Einfahrzeit nur vage Schätzungen abgeben. Das wollen wir vermeiden. Sobald sich ein Boot im Besitz des Eigners befindet, wird es für den Praxisbetrieb mit persönlich gewähltem Equipment komplettiert, dessen Umfang und Gewicht sich ebenfalls auf die Verbrauchswerte auswirkt. Natürlich sind wir uns darüber im Klaren, dass die gegenwärtigen Kraftstoffpreise vor der Anschaffung eines Bootes berücksichtigt werden müssen. Doch wenn man bedenkt, dass der deutsche „Normalskipper“, zumindest statistisch gesehen, deutlich weniger als 50 Stunden pro Saison mit seinem Boot unterwegs ist, relativieren sich der Stellenwert des Spritkonsums und die damit einhergehenden Ausgaben. Allgemeingültige Voraussetzungen für einen überschaubaren Kraftstoffverbrauch sind, unnötigen Ballast von Bord zu nehmen, auf eine ausgewogene Gewichtsverteilung und richtige Trimmung, regelmäßige Wartung der Antriebstechnik und auf ein „glattes“, also unbewachsenes Unterwasserschiff zu achten. Überdies sollte man auf rasantes Beschleunigen verzichten und möglichst oft im ökonomischen Drehzahlbereich fahren.
Feuer an Bord
Feuer an Bord bedeutet für den Skipper und seine Crew eine extreme Ausnahmesituation. Neben einem Wassereinbruch ist das Feuer der zweite mögliche GAU auf einem Sportboot. Hat man im Haus oder auch im Auto meist noch die Möglichkeit, schnell Unterstützung durch die Feuerwehr zu bekommen, so sieht dies an Bord häufig anders aus. Nicht nur, dass die Yachthäfen in der Regel etwas außerhalb der Ortschaft liegen und somit von der Feuerwehr nur nach langen Anfahrtswegen zu erreichen sind, in vielen Fällen reichen die Schlauchverbindungen der Wehren gar nicht über den Steg bis zum Boot. Somit ist der Skipper bei Feuer am Liegeplatz und erst recht auf See auf seine eigene Kompetenz und Ausstattung angewiesen. Meistens führt ein Feuer an Bord zum Totalverlust der Yacht, doch vieles kann gerettet werden, wenn die sich an Bord befindenden Personen im Vorfeld und beim Unfall richtig handeln. Denn auch an hier gilt: Jedes Feuer fängt klein an. Am besten ist es jedoch, man es lässt es erst gar nicht soweit kommen.
Peilen
Auch im Zeitalter der Elektronik sollte man ein paar Dinge des navigatorischen Handwerkszeugs immer noch beherrschen. Nein, nicht die Vierstrichpeilung über die Peilscheibe, sondern das, was wirklich in der Praxis vorkommt. Kennen Sie noch jemanden mit einer Peilscheibe an Bord? Ist es eine Halbkreis- oder Vollkreisscheibe? Was, Sie kennen diese Varianten gar nicht? Brauchen Sie auch nicht. Bei einem Gang durchs Schifffahrtsmuseum werden Sie diese navigatorischen Utensilien eher finden als an Bord eines Sportbootes. Gleiches gilt für einen Peilaufsatz auf dem Steuerkompass. Beide Varianten kommen noch aus der Zeit als der Kompass ein sehr teures und somit in vielen Fällen einzigartiges – im wörtlichen Sinne – Gerät an Bord war. Dies hat sich sehr geändert. Jede Yacht hat – oder sollte zumindest haben – neben dem Steuerkompass vor dem Steuerstand einen Reservekompass. Hiermit ist nicht das Display der Kompassanzeige in Ihrem GPS gemeint, sondern ein zweiter stromunabhängiger Magnetkompass. Für diese Zwecke ist ein Handpeilkompass, der sich mittels spezieller Halterung auch am Steuerstand für das Kurshalten eignet, bestens geeignet.
Mooring-Bojen
Nun, was da genau am anderen Ende der Bojen-Leine auf Grund liegt, tut eigentlich nichts zur Sache. In den meisten Fällen werden Mooringbojen von kommerziellen Hafenbetreibern oder ortsansässigen Vereinen verankert. Die wissen über die speziellen Reviereigenheiten bescheid, wissen aber auch, was sie ihrer Mooring zutrauen können. Von Bedeutung für die Sicherheit Ihres Bootes ist einzig und allein, wie schwer das �?Etwas am Grunde�? ist! Entscheidend für die annähernd genaue Antwort ist eine Größe aber mit Sicherheit nicht, die des Gewichtes des Bootes! Die spielt nur eine untergeordnete Rolle. Entscheidende Faktoren für die Masse, das Gewicht, das der Mooring-Boje �?zu Grunde liegt�?, ist die Angriffsfläche des Windes auf die Überwasserstruktur des Bootes und die Struktur des Unterwasserschiffes, auf die Strömungen Einfluss nehmen können. Zur Ermittlung des rechten Bojen-Ankergewichtes müssen also die Flächen der Wind- und der Strömungsangriffsflächen ermittelt werden. Wie das?
GFK-Pflege
Wir wollen im Folgenden einige Tipps und Mittel nennen, die Ihnen helfen, dass die Außenhaut ihres Bootes die kommende Saison gut übersteht. Zuerst heißt es, sich durch die groben Verschmutzungen durchzuputzen, um dann den exakten Putzplan für die Außenhaut zu erstellen. Nur wenn das Gelcoat oder die Farbschicht vom Schmutz befreit sind, können die weiteren Arbeitsschritte angegangen werden. Diesen Arbeitsgang sollte man nicht bis in die ersten Frühjahrstage verschieben; eine ordentliche Grundreinigung im Herbst erleichtert den Frühjahrsputz ganz erheblich, denn der Schmutz „frisst“ sich im Winter fest. Also ruhig schon mal beim Kranen im Herbst mit reichlich Wasser den gröbsten Dreck, zunächst ohne Zusatzmittel, entfernen. Erst jetzt kommen die Mittel zum Einsatz. Vergessen Sie nicht die Gebrauchanweisung für den Reiniger zu lesen, denn nicht alle Produkte werden auf die gleiche Art verarbeitet. Achten Sie neben der Dosierung (einige Mittel werden als Konzentrat angeboten) auf die Einwirkzeiten und die eventuellen Abwaschzeiten. Bei sehr konzentrierten Lösungen ist die Benutzung von Kunststoffhandschuhen sehr wichtig, denn die Reiniger haben eine stark entfettende Wirkung.
GFK-Reparatur
Sollten Sie nicht gleich nach dem Schaden mit der Reparatur beginnen können, so dichten Sie auf jeden Fall den Schadensbereich mit Folie oder Tape ab, so dass kein Wasser oder wenigstens nur wenig Feuchtigkeit eindringen kann. Ist das Laminat doch feucht geworden, so sollte erst nach dem Trocknen mit der Reparatur begonnen werden. Wir haben bei unserem Reparaturbeispiel Glück, aber auch Pech. Glück insofern, als wir unser Boot aus dem Wasser holen können und nicht über Kopf oder vom Dinghi aus im Wasser reparieren müssen. Aber dass wir auch etwas Pech haben, stellt sich bei der Reparatur heraus. Erstens ist die Schadensstelle von innen nicht erreichbar und zweitens befindet sich der Schaden genau im Knick des Rumpfes. Das bedeutet in der Regel einen richtigen Laminatbruch. Denn in der Ebene hätte das GFK vielleicht eher nachgegeben und gefedert.
Gelcoat-Schäden
Bevor es an die Beseitigung des Schadens geht, etwas Wichtiges vorweg: Sorgen Sie wenn möglich gleich nach dem Schaden dafür, dass keine Feuchtigkeit ins Laminat eindringt. Auch ein kleiner Kratzer kann über Tage hinweg eine große Wirkung haben. Daher sollte der Skipper, noch bevor das Schiff sich wieder in Fahrt setzt, eine einfache Not-Reparatur mit Klebeband vornehmen. So kann später die Reparatur schneller beginnen, denn auf einem feuchten oder nassen Schaden kann nicht gearbeitet werden. Ist trotzdem Feuchtigkeit eingedrungen, zum Beispiel weil sie den Schaden erst später festgestellt haben, sorgen Sie für ein gründliches Trocknen der Schadensstelle. Es ist gar nicht so einfach festzustellen, ob nur eine Gelcoat-Reparatur fällig ist oder ob doch mit einigen Lagen Matte die Struktur der Außenhaut wieder geschlossen werden muss. Das wirkliche Schadensausmaß ist erst zu sehen, wenn die Stelle von allen losen Partikeln freigekratzt ist. Ein erstes sehr resolutes Kratzen mit einem spitzen keilförmigen Gegenstand schafft Klarheit. Es soll allerdings beim Kratzen das „Löchlein“ nicht zum „Loch“ vertieft werden, es gilt nur, die losen Teile zu entfernen. Kann man jetzt weiße Stellen in der sonst dunkel bis leicht durchsichtigen Glasfaserstruktur sehen, so ist der Schaden doch eine Nummer größer. Die hellen Stellen machen deutlich, dass sich die einzelnen Lagen voneinander getrennt haben oder dass die Glasfaser gebrochen sprich, delaminiert ist. Jetzt reicht einfaches Gelcoat nicht mehr aus.
Tauschutz
Das trifft vor allem bei Leinen zu, die wie Festmacher und Springs mit ihren Reibungspunkten fest fixiert sind. Das „Schamfilen“ kann man an solchen Leinen ganz gut vermeiden, wenn man die Leine (das Tau) an den gefährdeten Stellen schützt. Was wir dort aufgezeichnet haben, ist sicher für den „alten Fahrensmann“ nichts Neues, soll aber einmal wieder in Erinnerung gerufen werden und für den Einsteiger Hinweis und Anregung sein. Wir setzen dabei vo-raus, dass die Enden (die Tampen) des Taues (Kardeele und einzelnen Garne), das z.B. als Festmacher verwendet werden soll, wenn es sich um ein Nylon- oder Polyäthylentau handelt, gut miteinander verschweißt und danach noch mit Nylongarn oder -draht - das ist ein starker Nylonfaden - getakelt worden sind. Das gilt natürlich auch für Hanf- und Manilatauwerk. Bei diesen Naturfasertauen ist eine Betakelung mit Takelgarn unerlässlich
Schleusentechnik
Um die für die Schifffahrt notwendige Wassertiefe zu erreichen, wurden in viele Flüsse Wehre gebaut. Schleusenkammern erlauben den Schiffen, den so entstehenden Niveauunterschied zu überwinden. Dicht schließende Tore am oberen und unteren Ende der Kammer erlauben die Ein- und Ausfahrt der Schiffe. Zum Be- und Entleeren der Kammer dienen die Schützen, Ein- und Auslasskanäle, die durch Schieber reguliert werden. Im „Normalfall“ sind die Schützen im unteren Bereich der Schleusentore angebracht. Bei dieser Art der Schleusung geht das in die Schleusenkammer eingeleitete Wasser verloren. Deshalb hat man bei Schleusen, die große Höhenunterschiede überbrücken, so genannte Wasservorhaltbecken eingerichtet, in denen das abgelassene Wasser aufgefangen und bis auf einen geringen Wasserverlust immer wieder verwendet werden kann. In solchen Schleusen wird das Wasser nicht ins Unterwasser abgelassen, sondern durch seitliche, in der Schleusenwand mündende Kanäle zu- und abgeleitet. Hat man dabei das Pech, vor einem dieser Kanäle beim Schleusen zu liegen, muss man sehr aufpassen, dass das Boot nicht gedreht oder angesaugt wird. Da ist sichere Leinenführung immer von besonderer Bedeutung.
Rettungsinseln
Tasche oder Container, an Deck oder in der Backskiste? Schon bei der Lagerung wird es knifflig. Eine Tasche gehört nicht unbedingt an Deck. Ein Container ist allein schon wegen seiner festen Hülle den mechanischen Belastungen dort besser gewachsen. Aber auch der Container an Deck, der mehrere Sommer im Wechselspiel der Temperaturen verbracht hat, ist ungeahnten Belastungen ausgesetzt. Ist zum Beispiel durch Kapillarwirkung über die Reißleine Wasser eingedrungen, so „kocht“ dieses Wasser tagsüber und sorgt für schnelle Zerstörung im Inneren. Im Mittelmeer werden leicht 80 bis 90 Grad Celsius im Container einer Rettungsinsel erreicht. Eine Insel in der Tasche in einer soliden Backskiste scheint so der bessere Aufbewahrungsort zu sein. Eine Sechs-Personen-Insel wird im Sturm jedoch kaum durch jedes Crewmitglied aus der tiefen Backskiste zu holen sein, um sie dann zu aktivieren. Für den besten Ort oder die sicherste Hülle gibt es also kein Patentrezept. Wichtig ist ein Platz, der die mechanischen und witterungsbedingten Belastungen so gering wie möglich hält.